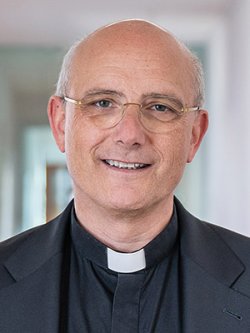Quelle: Imago / Panthermedia / Hecke

FREISING. Für die einen ist es die reine Idylle, für die anderen eher ein Ausdruck von Tristesse: Das Leben auf dem Dorf. Die Zeitschrift OWEP beleuchtet unterschiedliche Facetten dörflichen Lebens in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das historische Erbe aus den Zeiten des Kommunismus, das bis heute viele ländliche Strukturen prägt. Auch aktuelle Entwicklungen finden Beachtung – gerade solche, die abseits urbaner Zentren entstehen und dennoch weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen haben.
Olivenbäume auf den adriatischen Inseln, Tourismus in den Ostalpen, riesige Bauernhöfe in den eurasischen Steppen oder Moore in den nördlichen Regionen: Die Vielfalt dörflichen Lebens im Osten Europas ist enorm. Dennoch gibt es verbindende Erfahrungen, schreiben die beiden Wissenschaftler Alexander Vorbrugg und Lana Peternel in ihrem Einführungstext: Die Spuren der industrialisierten Landwirtschaft, der sozialistischen Kollektivierung und der postsozialistischen Krisen und Konflikte prägen bis heute das Leben.
Der tschechische Historiker Matěj Spurný, macht deutlich, welchen Verlust die Vertreibung der Deutschen für die Grenzregion und die tschechische Kulturlandschaft bedeutete. Um ein besonders dunkles Kapitel der deutschen Geschichte geht es in dem Beitrag „Verbrannte Dörfer in Belarus“ – für die exemplarisch der Name Chatyn steht. Die Slawistin Nina Frieß befasst sich mit der russischen Tradition der Dorfprosa, die in literarischer Form zeigte, welche Folgen die Auflösung der Dörfer und der dörflichen Gemeinschaften mit sich brachte. Vor diesem Hintergrund lasse sich, so die Autorin, nachvollziehen, „warum es vielen Menschen heute sogar attraktiver erscheint, in einen Krieg zu ziehen als in der Perspektivlosigkeit russischen Dörfer und Kleinstädte zu verharren.“
Thomas Roser, Balkan-Korrespondent in Belgrad, berichtet in seiner Reportage über den Verfall in Serbiens schrumpfenden Dörfern: Hält der Trend an, könnten nach Prognosen der Demografen bis 2050 zwei Drittel der 4.700 Dörfer des Landes verlassen sein. Eine andere Herausforderung beschreibt der Journalist Alexander Welscher. Er hat das litauische 500-Seelen-Dorf Rūdninkai besucht, wo die Bundeswehr zum Schutz der Nato-Ostflanke bis zu 5.000 Soldaten stationieren will und dafür eine ganze Militärstadt aus dem Boden gestampft wird. Zwei weitere Beiträge befassen sich mit dem Nachbarland Polen: OWEP-Redaktionsmitglied Matthias Kneip war im „bemalten Dorf“ Zalipie. Dort verzieren fast alle Bewohner ihre Häuser immer wieder auf‘s Neue mit floralen Motiven. Der Polen-Korrespondentin Gabriele Lesser wiederum begegnete erstaunlicher Unternehmergeist: Sie führte ein Interview mit einer Hotelbesitzerin, die sich auf Agrotourismus der Luxusklasse an den Masurischen Seen spezialisiert hat.
Den Beitrag "Serbiens schrumpfende Dörfer" von Thomas Roser können Sie hier im Volltext lesen.